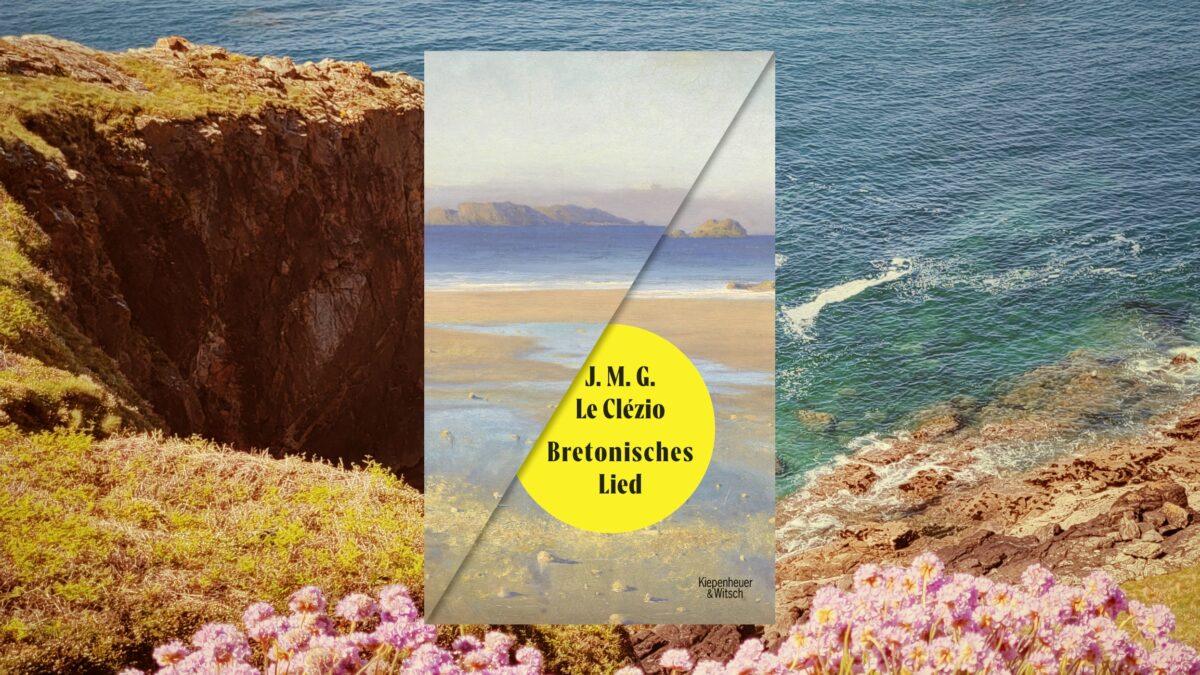Der Nobelpreisträger J. M. G. Le Clézio schöpft in seinen Werken häufig aus seinen Erlebnissen in Mauritius und Afrika. Das späte Werk „Bretonisches Lied“ (frz. „Chanson bretonne“) handelt von weniger exotischen Sujets, denn es geht um die Kindheits- und Jugenderinnerungen des Autors, die sich in der Bretagne und während der Zeit der Okkupation abspielten. Zwischen archaischer Idylle in der Bretagne und einem versteckten Leben vor den Deutschen entführt uns Le Clézio in eine Welt, die es heute nicht mehr gibt.
Der Band, der in der deutschen Übersetzung einfach „Bretonisches Lied“ heißt, enthält eigentlich zwei in der Anlage sehr verschiedene Erzählungen („Bretonisches Lied“ und „Das Kind und der Krieg“), die jeweils aus mehreren Unterkapiteln bestehen und aus der Perspektive des rückblickenden Ich-Erzählers geschrieben sind. In der ersten Erzählung nimmt uns der Erzähler mit in eine aus kindlicher Perspektive geschilderten Bretagne in den 50er Jahren, die vor allem durch ihre Natur, die traditionelle Lebensweise und die von der Landwirtschaft und Fischerei geprägten Gesellschaft auffällt.
Es ist eine Bretagne, in der Kinder unbesorgt auf der Straße spielen können, wo sich ältere Damen um die Kinder kümmern, wo es noch keine Massenfischerei, sondern private Fischerboote gibt, denen der Autor im Rückblick nachweint. Es ist eine verschwundene und verwunschene Bretagne, fast wie im Märchen, wie der Erzähler immer wieder feststellt, der die Landschaft und Gegenden seiner Kindheit in der Gegenwart erneut bereist hat. Dort, wo früher Äcker oder Felder waren, stehen heute Kreisverkehre, Fabriken und die nichtssagenden Gebäude von Gewerbegebieten. Eine traurige Form der Entmystifizierung dieses Landes, in dem auch die Artussage spielt, und der Anpassung an die Globalisierung hat über die Jahrzehnte stattgefunden.
Und doch war in der Bretagne, wie sie früher war, nicht alles perfekt. So gab es Armut. Und das Bretonische, die Sprache der Bretagne, hatte gegenüber dem Französischen lange eine nachgeordnete Stellung, so wie alle Dialekte gegenüber dem Dialekt der Île-de-France als nachrangig galten. Das Bretonische war daher vor allem bei den Jüngeren ein wenig außer Gebrauch gekommen, da man sie in der Schule anhielt, Französisch zu sprechen. Die Älteren sprachen in der Kindheit des Erzählers noch Bretonisch, sodass er immer wieder einzelne Brocken aufschnappt, zum Beispiel wenn sie über das Wetter sprechen, doch weit davon entfernt ist, Bretonisch wirklich zu verstehen oder zu sprechen.
Die Familie des Erzählers, das sind die Pariziani, die während der Sommerferien aus dem Süden für mehrere Wochen in die Bretagne reisen und sich in dieser Zeit unter die Einheimischen mischen. Ihr Aufenthalt führt sie zu Beginn der 50er Jahre regelmäßig nach Sainte-Marine im Bigoudenland. Auch heute noch besitzt der inzwischen über 80-jährige Nobelpreisträger Le Clézio ein Haus in der Bretagne. Seine Familie war und ist, so schreibt er in „Chanson bretonne“, durch eine besondere Beziehung mit der bretonischen Erde verbunden, die für ihn ein „Heimatland“ sei, von dem er abstamme. Sein Vater und seine Mutter seien bretonischer Abstammung, auch wenn sie später in Afrika gelebt hätten.
Jean-Marie Gustave Le Clézio wird 1940 geboren und stammt aus einer bretonischen Familie, die später nach Mauritius auswanderte. Der Vater ist Engländer und durfte, wie wir in der Erzählung „Das Kind und der Krieg“ erfahren, aufgrund seiner englischen Herkunft nicht aus Afrika in das von den Deutschen okkupierte Frankreich einreisen, deren Feinde die englischen Alliierten waren. Der Rest der Familie aus Mutter, zwei Söhnen und Großmutter war währenddessen in Nizza und konnte mit dem Vater zunächst noch per Briefpost, dann mehrere Jahre überhaupt nicht mehr kommunizieren. Es herrschte eine notgedrungene Funkstille, Vater und Mutter waren ohne Nachrichten voneinander.
Die Folge war, dass sich die Mutter und Großmutter mit den beiden Kindern in ein Versteck im südfranzösischen Hinterland begaben, um nicht von den Deutschen gefunden und deportiert zu werden, da sie englischer Abstammung sind oder man ihnen Nähe zu England nachsagen könnte. Die Wahl fällt auf das kleine Bergdorf Roquebillière, wo sie eine Unterkunft bei einer Familie finden und das weit genug in den Bergen liegt, um von den Deutschen unbemerkt leben zu können. Der Kriegsbericht ist der interessantere Teil der beiden Erzählungen „Bretonisches Lied“ und „Das Kind und der Krieg“, hier erfährt man einige Geschichten zum Krieg und zur Okkupation, berichtet aus einer halbkindlichen, halberwachsenen Perspektive, die den Krieg als solchen, aber auch den Zweiten Weltkrieg in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen.
Der Kriegsbericht aus einer Kindperspektive erinnert an „Das große Heft“ (1986, frz. „Le grand cahier“) von Agota Kristof, das den Krieg auf eine ungleich rohere, grausamere Weise schildert, als Le Clézio dies in seinem Bericht tut. Bei Le Clézio erscheint der Krieg als Kindheits-Verhinderer, aber auch als Gefahr, die es zu überstehen gilt. Es ist ein fast kindliches Verständnis von Krieg, in dem die Deutschen kaum vorkommen, da sie in Roquebillière nicht auftauchen. Die Deutschen sind die Feinde, vor denen sich die Familie verbirgt und hofft, nicht mit ihnen in Konflikt zu geraten, während der Vater, ein Arzt, weiterhin in Afrika darauf wartet, dass der Krieg vorbeigeht und er wieder zu seiner Familie kommen kann.
Das Leben im Versteck, das schwierige Leben für die Familie und die Kinder und dennoch das Leben als Kind, das man ja trotzdem bleibt. Der Krieg macht das Leben außergewöhnlich, schwierig, gefährlich. Nur am Vormittag dürfen die Kinder mit der Großmutter zum Markt gehen, um einzukaufen. Die Kinder spielen vor allem drinnen und nutzen alles, was ihnen in die Hände fällt, als Spielzeug. Sie haben einen Bombenanschlag in Nizza miterlebt, der sie geprägt hat, und wissen um die Gefahr. Auch über den unerträglichen Hunger schreibt Le Clézio, der sich wie ein ständiges Loch im Bauch anfühlt und der einen im Wach- und Schlafzustand begleitet.
Beide Erzählungen haben vor allem eine Schwäche: Sie reihen Anekdoten, Erlebnisse, Erfahrungen und Geschichten ohne größere Ordnung aneinander, sodass der Eindruck einer mangelnden Struktur entstehen kann, was sich beim Lesen auch ein wenig ermüdend auswirkt. Die Erzählung zu den Urlaubstagen in der Bretagne trägt eher eine persönliche Note in sich und sticht vor allem durch ihren Bericht über den Archaismus der Bretagne in den 50er Jahren heraus, gepaart mit ein wenig Nostalgie und Sehnsucht.
Besser gefällt mir die eher allgemeingültige Erzählung über die Kriegserfahrung aus der Sicht von Kinderaugen, die die ganz spezifische Perspektive von Kindern auf diesen zivilisatorischen Ausnahmezustand in den Vordergrund rückt. Hier geht es wirklich um etwas Größeres, das auch eine historische Bedeutung hat. Obwohl auch in der zweiten Erzählung auf anekdotenhafte Weise erzählt wird, fällt das angesichts des interessanten Sujets weniger auf. Es kommt weniger Leerlauf und, ja, auch weniger Langeweile auf.
Trotz dieser berechtigten kritischen Worte kann ich die Erzählungen Le Clézios vor allem Leuten empfehlen, die einen Blick auf das Frankreich der 40er und 50er Jahre werfen wollen und ein historisches Interesse und/oder ein Interesse für die Bretagne haben. Le Clézio ist ein erfahrener Erzähler, dem man seine Lebenserfahrung anmerkt.
Bewertung: ⭐⭐⭐⭐ 3,5/5
J. M. G. Le Clézio: Bretonisches Lied. Aus dem Französischen von Uli Wittmann. Kiepenheuer & Witsch Verlag. 22 €.